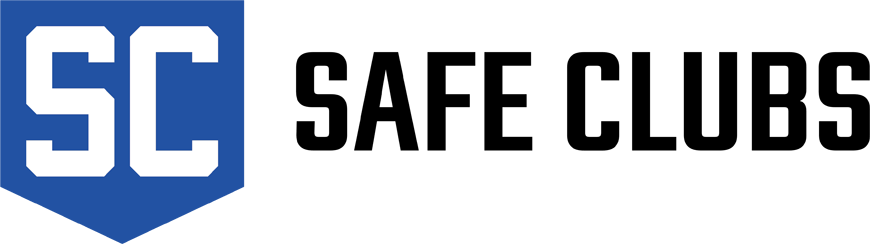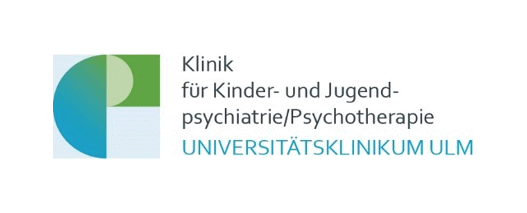Kapitel 4: Durchführung der Intervention
Intervention – Einführung
Kapitel 1: Intervention – Was ist das?
Kapitel 2: Vor der Intervention
Kapitel 3: Einstieg in die Intervention
Kapitel 4: Durchführung der Intervention
Kapitel 5: Abschluss der Intervention
Nachdem die Ansprechperson erste Schutzmaßnahmen ergriffen hat, gibt es weitere Schritte, die zu einem Interventionsprozess gehören. Wie können Ansprechpersonen mit beschuldigten Personen umgehen? Der Podcast mit Annika Söllinger und Paula Edler liefert dazu Antworten:
Neben dem Umgang mit Betroffenen und beschuldigten Personen, sollten sich die Ansprechpersonen auch überlegen, wie sie mit weiteren Personengruppen umgehen. Im folgenden Video geht es um Fragen, die den Einbezug und die Information von Erziehungsberechtigten, anderen Vereinsmitgliedern und der Öffentlichkeit betreffen. Dafür haben wir mit Henrik Jeske, Mitarbeiter des Instituts für Soziologie und Genderforschung der Deutschen Sporthochschule Köln und Manager der deutschen Rollstuhlbasketballnationalmannschaft gesprochen.
Dokumentation und weitere Rahmenbedingungen der Intervention
Ein weiterer, wichtiger Aspekt im Interventionsprozess ist eine konsequente, disziplinierte und zeitnahe Dokumentation. Insbesondere, wenn der Fall strafrechtlich verfolgt werden soll, ist es wichtig, eine ausführliche Dokumentation vorlegen zu können. Gleiches gilt auch für eine anschließende Aufarbeitung des Falls im Verein und mit externen Expert*innen. Wichtig ist, dass ihr strukturell deutlich zwischen der Dokumentation von Gesprächsverläufen und eigenen Gedanken, Einschätzungen etc. unterscheidet, um genau nachvollziehen zu können, welche Informationen von welcher Person kommen und es dabei nicht zu Ungenauigkeiten kommt.
In eurer Dokumentation beschreibt ihr nicht nur die Situationen und Beteiligten, sondern auch die unternommenen Schritte und deren Zeitpunkte. Ihr könnt euren eigenen Dokumentationsbogen erstellen, oder auf solche zurückgreifen, die bei Ansprechpersonenschulungen ausgeteilt und besprochen werden.
Hier findet Ihr ein Beispiel der dsj.
Wenn ihr den Dokumentationsbogen griffbereit habt, könnt ihr relevante Informationen systematisch erfassen und seid auch in einer Notsituation handlungsfähig. Sollte eine schriftliche Dokumentation zeitnah nicht möglich sein, könnt ihr die Informationen auch mit einem Diktiergerät bzw. der Aufnahmefunktion des Smartphones, festhalten. Wichtig: Damit ist nicht gemeint, ein Gespräch mit hinweisgebenden Personen unmittelbar aufzuzeichnen, sondern die erhaltenen Informationen im Nachgang einzusprechen!
Wichtig ist, dass Dateien der Gesprächsnotizen und Protokolle verschlüsselt werden, um einen Zugriff unbefugter Personen auf sensible Daten zu vermeiden. Vertraulichkeit ist hierbei von höchster Bedeutung. Dazu müsst ihr sowohl im digitalen Raum als auch ganz real einen sicheren Ort schaffen, um die Daten zu schützen. Um die Sicherheit der Daten zu erhöhen, wird empfohlen Informationen nicht auf privaten Endgeräten (Laptops, PCs, Smartphones, etc.) zu speichern. sondern auf sichere cloudbasierte Systeme zurückzugreifen. Dokumente in Papierform sollten in verschlossenen Schränken aufbewahrt werden.
Abschließend könnt ihr die Dokumentation auch dafür nutzen, im Jahresbericht, z.B. auf der Mitgliederversammlung, über die Anzahl von gemeldeten und bearbeiteten Fällen zu berichten. So könnt ihr das Thema weiterhin transparent platzieren und die Mitglieder für die Thematik sensibilisieren.
Selbsttests
✍
✍
✍
weiter zu » Kapitel 5: Abschluss der Intervention